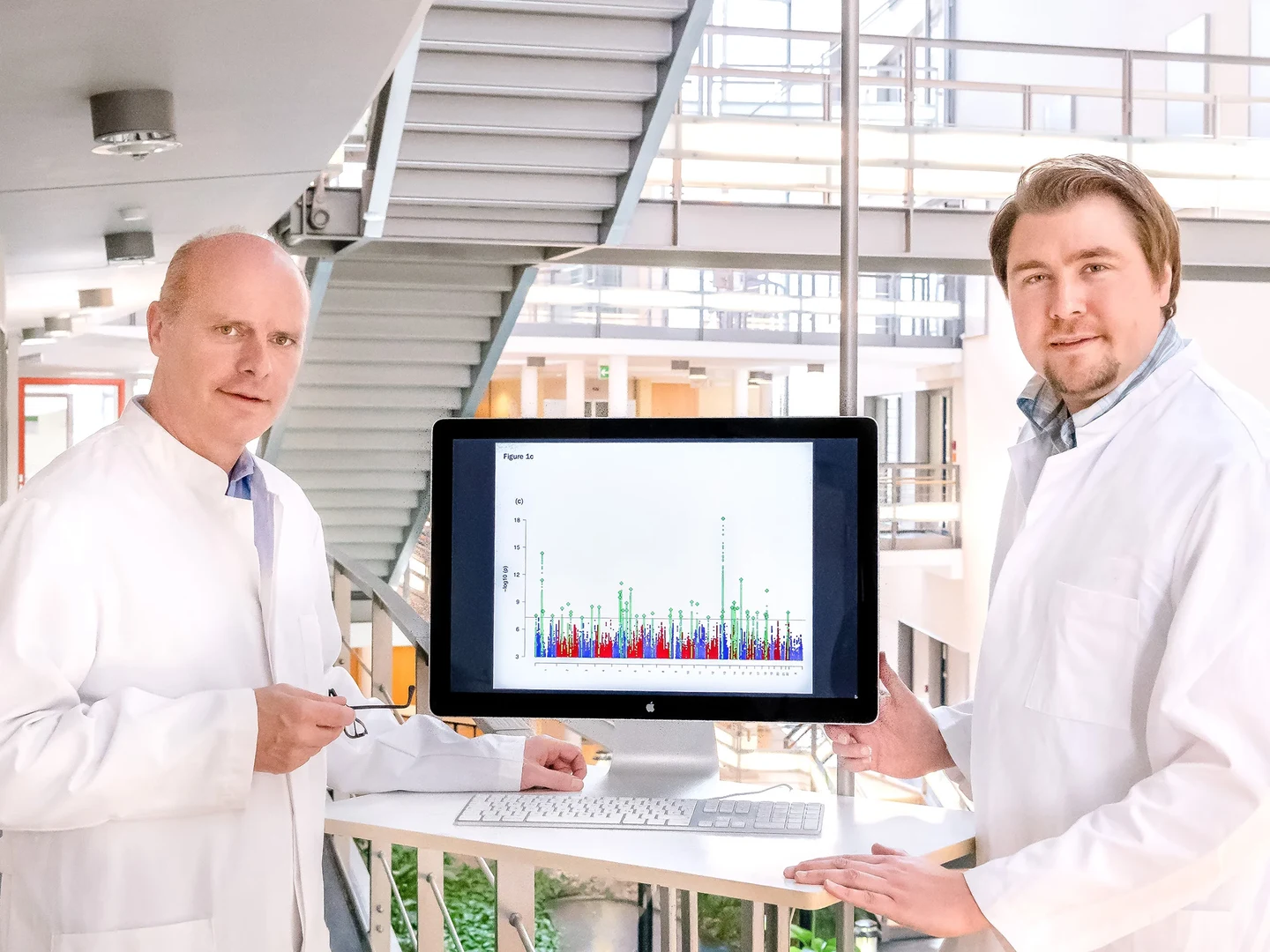Negative Gedankenschleifen, schwindender Antrieb und Todesgedanken sind typisch für die Depression. Die Folgen der Erkrankung, zum Beispiel Arbeitsunfähigkeit, stationäre Behandlungen und Frühverrentungen, haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. „Das persönliche Leid der Betroffenen und die volkswirtschaftlichen Folgen sind dramatisch“, sagt Prof. Dr. Markus Nöthen, Direktor des Instituts für Humangenetik am Universitätsklinikum Bonn. „Die vorhandenen Medikamente helfen nicht bei allen Patienten, der Forschungsbedarf ist deshalb groß.“
Ein erblicher Zusammenhang ist offenkundig, auch wenn er nur mit großem Aufwand nachzuweisen ist. „Viele Prozesse im Gehirn sind an der Depression beteiligt, die Beiträge einzelner Gene sind deshalb gering“, sagt Dr. Andreas Forstner, der zusammen mit Prof. Nöthen die an der Studie beteiligte Bonner Arbeitsgruppe leitet. Damit die Verdachtsregionen auf dem Erbgut nicht im Grundrauschen genetischer Unterschiede untergehen, brauchen die Wissenschaftler eine möglichst große Stichprobe, um die einzelnen beteiligten Gene sicher nachzuweisen.
Das internationale Psychiatric Genomics Consortium (PGC) fügte alle verfügbaren Gen-Daten zusammen und wertete sie in einer einzigen Datenbank mit mehr als 135.000 Patienten aus. Die DNA der an Depression Erkrankter wurde mit dem Erbgut von 344.000 Kontrollpersonen abgeglichen. Bei der statistischen Auswertung schälten sich insgesamt 44 Verdachtsregionen heraus, die mit der psychischen Störung in Zusammenhang stehen. Davon handelt es sich um 30 neu entdeckte Genorte für Depression. 14 Erbgutregionen, die Forscher bereits vorher entschlüsselt haben, wurden darüber hinaus bestätigt.
An der Studie arbeiteten mehr als 200 Wissenschaftler weltweit
Mehr als 200 Wissenschaftler weltweit arbeiteten in der groß angelegten Studie mit. „Viele Umweltfaktoren tragen zur Depression bei, aber die Identifikation der genetischen Faktoren stößt die Türen zu den biologischen Ursachen auf“, sagt Dr. Naomi Wray von der University of Queensland in Australien, die zusammen mit Dr. Patrick F. Sullivan, Direktor des Zentrums für Psychiatrische Genomik an der University of North Carolina School of Medicine (USA), die Studie leitete. „Mit weiterer Forschung sollte es möglich werden, neue Therapien zur Behandlung der schweren Depression zu entwickeln“, sagt Sullivan.
Die Wissenschaftler vom Universitätsklinikum Bonn trugen mit der Untersuchung des Erbguts von fast 600 Patienten und rund 1.000 Kontrollpersonen zur Studie bei. Für Prof. Nöthen sind die neuen Erkenntnisse ein großer Schritt: „Jedes zusätzlich identifizierte Gen, das mit der schweren Depression zusammenhängt, trägt zur Aufklärung der zugrundeliegenden biologischen Mechanismen dieser verbreiteten Erkrankung bei.“
Publikation: Genome-wide association analyses identify 44 risk variants and refine the genetic architecture of major depression, Nature Genetics, DOI: 10.1038/s41588-018-0090-3
Kontakt für die Medien:
Prof. Dr. Markus M. Nöthen
Institut für Humangenetik
Universitätsklinikum Bonn
Tel. 0228/28751101
E-Mail: markus.noethen@ukb.uni-bonn.de