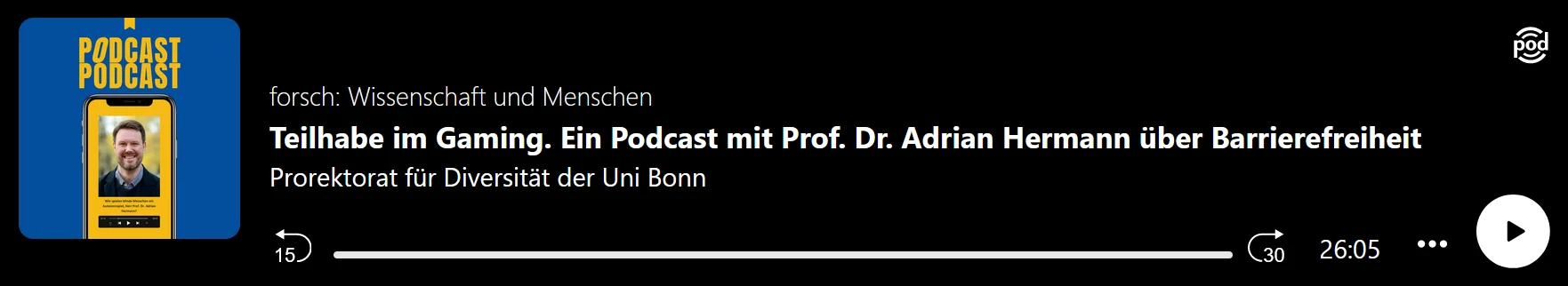Thea Fabian:
Video game consoles, gaming… these things are associated with having fun, for most people. But to individuals who are blind or physically disabled they are not the same thing. The gaming industry ignored the needs of such individuals for a long time. Now, however, there are technologies that enable the inclusion of people with disabilities.
I am looking forward to a talk with Professor Adrian Hermann, a prominent researcher in this field. But we will also be speaking about accessibility and inclusion on a general level. Hi Professor Hermann, it’s great to have this opportunity to speak with you.
Professor Dr. Adrian Hermann:
Hi, it’s great to be here!
Thea Fabian:
I see you have brought some things along, which you have laid out here on the table. Would you just tell us a bit about all that?
Professor Dr. Adrian Hermann:
Gladly; I have been researching accessibility from a cultural studies standpoint for a while now. These items I have brought along concern accessible gaming, i.e. video gaming, and other everyday technologies. These items demonstrate how accessibility is not only a relevant topic in the medical field, but also in regard to everyday leisure-time technologies.
So I have here a Microsoft Adaptive Controller for Xbox, and the accessible controller for Sony Playstation, which came out relatively recently—at the end of last year. And I have a few other things we may talk about later as we get into discussing accessibility generally.
Thea Fabian:
OK, let’s talk about the controllers first. Great strides have been made in recent years in technologies designed to enable people with disabilities to use gaming consoles for video gaming. If you would, discuss these developments for us and tell us how the technology works.
Professor Dr. Adrian Hermann:
Making video gaming more accessible has been an existing concern for a long time, but mostly only on the part of specialized manufacturers and do-it-yourselfers interested in developing the technologies. Some people have just created their own setups allowing them to operate a console with one arm only, for example, or overcoming other mobility restrictions so they can play video games. Such solutions have always been found, but now people are getting official support, from Microsoft for example, which has brought out the Microsoft Adaptive Controller. Manufactured and directly distributed by Microsoft, the controller makes it very easy to make my own setup, with my own settings configured to meet my personal needs. So I can connect it directly to my game console, in this case an Xbox. Most people will be familiar with game controllers like this, from Nintendo or Playstation, for example, which have various buttons and joysticks. But if I can’t use both of my hands, for example, I will have trouble using it, so I need a different way. The Microsoft Adaptive Controller allows me to do precisely that, allowing me to customize the operating setup to suit my personal requirements.
Thea Fabian:
What are some of the possibilities?
Professor Dr. Adrian Hermann:
It’s quite simple: for basically every button I have on the regular controller, i.e. the controller that comes in the package, this controller allows connecting a separate switch, joystick, button or whatever have you via jack, enabling me to use the functionality of that button. So I can build my own setup, and have different buttons for the various functions which I can place in such a way that I am able to reach them and hit them.
Some will use their shoulder, others their leg, knee, head or whatever. I can also connect more sophisticated accessibility devices, like a joystick operable by mouth, or a device allowing me to trigger a functionality by blowing, or other such movement. All of that is possible. And this adaptive controller is the link between my setup of input elements and the game console interfaces.
Thea Fabian:
That must mean a lot for the people who are now able to enjoy gaming like everybody else.
Professor Dr. Adrian Hermann:
What I find particularly important is how accessibility is an issue relevant to fun and leisure, which is an integral part of our lives. It is an important issue, and not just something that the government is obligated to take care of so individuals with disabilities can enjoy basic functions of citizenship. Like apply for a new passport and things like that. So it’s going beyond life’s necessities to encompass things that people simply enjoy doing. Accessibility is crucial for anyone dependent on barrier-free access—in this case access to video gaming.
It is of course a special situation when a person has loved video games all their life but then because of things like an accident, aging or life situation change become unable to play anymore. Accessible technologies allow me to keep doing this recreational activity that I really like and is one that I enjoy life.
Thea Fabian:
That is indeed how the people in the video I watched to prepare for this interview describe it. They were talking about a car racing game that blind people can play. I had certainly never heard of anything like that before. I saw that and was totally fascinated, thinking: “That is so amazing, how that person can drive the car around the track so expertly the whole time, without being able to see it?” Now how does that work?
Professor Dr. Adrian Hermann:
It works thanks to the input devices we just mentioned, on the one hand, which are a key part of the equation in making it possible. The other part is the software and how the game itself is designed, which too may have various accessibility configuration settings and options. It is thus a specific hardware-software setup that enables people to do such gaming.
Staying with the example of the car racing game, a range of possibilities are imaginable. For someone who can’t see the screen or has limited vision, for example, they might theoretically get a certain stimulus they feel on their one hand when they are running off the track. Such pressure or vibration controllers connected to the system let the player know they are moving left or right. So this is a matter of the input hardware used. Then of course the software may offer an option of keeping the car on track, for example, so the player doesn’t have to worry about that. The player can thus enjoy other aspects of playing the game while the software takes care of certain, more challenging aspects. These are some of the possibilities out there.
Thea Fabian:
The audio can be part of the gaming experience too, can’t it?
Professor Dr. Adrian Hermann:
Oh indeed! All the possibilities we have today in other media contexts are available, like “talkback” screen reader technology—voice output for things that normally you can only see on screen. So any media options out there can conceivably be realized. The topic is thus of great interest in media studies, as it’s ultimately about input, interfaces and interlocking media.
Thea Fabian:
In the video I also saw settings for color usage. Where do those come into play?
Professor Dr. Adrian Hermann:
Yes, well, settings that make it much easier for people with a particular kind of color blindness to do gaming have been around for a while, but the latest video games are offering more and more highly sophisticated features—especially games that are designed for accessibility. This often involves the controllers. Like in a game where the character’s life energy is displayed, shown by a number of red hearts that are full or partially drained. Someone who has trouble registering that can just change the color scheme so they are able to see the color used. With their specific needs met, they are then able to play this game without problems.
Thea Fabian:
It really is tremendous what all is possible today, everything that is out there. But considering the aspect of affordability, what health insurers cover costs to purchase such technologies?
Professor Dr. Adrian Hermann:
As far as I am aware, there isn’t much support from insurers, and that’s a problem. It is a major step that game console manufacturers have started offering these new technologies, building accessibility into their products, which anybody can go out and buy. Accessibility is thus more available nowadays, and the prices have come down somewhat. Of course, special setups still cost a good deal of money for those who require custom buttons, switches, joysticks and so on, in addition to the controller itself. It can get quite, quite expensive indeed, depending on what you need. All these things to my knowledge are not covered by health insurance, generally, just like the game consoles themselves, which are considered to be everyday technologies like computers and smartphones. These are not doctor-prescribable aids—not in Germany, at any rate. As our lives become more and more digitalized, these technologies are becoming more and more prevalent, be it gaming console, computer, smartphone or whatever. Of course when something needed for basic access to many things in society and in life is not covered by health insurance, it is an unfortunate situation.
Thea Fabian:
What do you think the future holds, what developments may be coming our way?
Professor Dr. Adrian Hermann:
It’s hard to say of course, but regarding accessibility generally, there may be developments forthcoming in the legal framework, like the medical aids regulation, but I am unable to say a whole lot about it. Yet accessibility is clearly an issue of increasing importance, as reflected in laws already passed and the evolving legal framework. While it is difficult to anticipate the developments, we do see the European Disability Act and other legislative decisions being made in European law. The requirements under such EU laws are then implemented in German national law. Thanks to these laws there will be a much clearer legal situation as of the year 2025, so that businesses will have to pay more attention to accessibility issues. Exceptions will be possible through the year 2030 for special cases, but the basic difference will be that private enterprises will have to be more concerned with accessibility, whereas currently it is only public institutions where this is the case—universities, authorities, etc. Further improvements are thus likely, and of course ideally these will be quite substantial.
Thea Fabian:
OK, we have talked about how this issue means that some people will miss out on opportunities if we neglect to take steps to ensure their inclusion. But how important is accessibility within society as a whole? Thinking for example buildings, workplaces etc.—the ramifications for construction.
Professor Dr. Adrian Hermann:
I believe accessibility will be seen as an issue of much greater importance than it is today. Construction changes are the kind that we can all see right in front of us, such as stairs and other situations that pose a problem for handicapped individuals encounter in everyday life. During the pandemic, probably everyone became suddenly grateful for automatic door openers operable by foot or even one’s knee, which were originally intended to reduce barriers for individuals with mobility restrictions. Such structural aspects of accessibility will undoubtedly become more of a focus in broader society, in Germany at any rate. That is my expectation, and we can only hope that that will be the case. And from my point of view as a scholar, it is interesting what you start to perceive once you start looking at the world from the lens of accessibility. That’s when it gets intriguing, going beyond specific aspects—you start to see things you might not otherwise have.
Thea Fabian:
Yes I see, and these changes make life easier for people without disabilities too, don’t they, not just people with disabilities, would you agree?
Professor Dr. Adrian Hermann:
Precisely, that’s right. Seeing things through the lens of accessibility reveals in fact that the issue is actually important to everyone; how barrier-free solutions can actually benefit everyone, be it on campus or in relation to recreational activities, such as gaming. It’s a multi-faceted issue that one can approach through different models. Ultimately however, what’s important is that we realize how everyone can benefit from barrier-free concepts, as we may all end up needing and using them at some point in our lives. Lowered curbs, for example, will make it easier for moms and dads out with a stroller to get around in the city—to cite one situation. That also applies to individuals who depend on a wheelchair for mobility. Voice command is another useful technology: which helps blind people, for example, use a smartphone. But I can use voice input in my car as well, for example, if I have the technology installed, allowing me to dictate text messages, as an example of something that everyone can benefit from. Senior citizens in particular benefit in a society concerned with accessible living, and we will all be old at some point, having trouble with our eyesight, or stamina or other aspects of living—at some point we will be grateful for such things.
Thea Fabian:
Accessibility is relevant to us all in one way or another. But it’s about more than just physical aspects of inclusion, isn’t it? What about people who have ADHD or autism, for example?
Professor Dr. Adrian Hermann:
There too, we need to all see things from an accessibility standpoint at some point, as people with such disorders—nowadays we talk about “neurodiversity”—are particularly affected. Such individuals can benefit significantly in their private lives or at work from an environment designed for greater accessibility than is typically the case today, becoming enabled to live more productive, happier lives. In the workplace, for example, there is so much potential out there in my opinion, around things that most people are not even really aware of, not being affected by the situation ourselves. So I see a great need here, and it is truly interesting how looking at things through the lens of accessibility helps us reflect on ourselves. What things do we take for granted, not seeing any problem, thinking anybody can just do that? Structural accessibility is never a complicated matter. For example: a room accessible only by going up a few steps. If there is no way past these steps, the room is basically inaccessible for a person in a wheelchair. That much is clear and apparent to everyone. But an accessibility issue involved around neurodiversity would be whether the announced event, work meeting, etc. to be held in that room lasts for a specified period of time, without going over for the usual 2–25 minutes. Many would not see this as an accessibility issue right off, but to people with ADHD or autism, meeting duration can be a crucial issue, if they are to feel comfortable in a work context. So these considerations open up a very wide range of potential accessibility issues.
Thea Fabian:
Earlier you touched on how looking at the meta level, from a culture theory and philosophical standpoint, accessibility turns out to be much more than the few examples that usually come to mind. You just now pointed out how there is a lot more to the issue than people tend to think, but do any other areas of society come to mind, specific examples?
Professor Dr. Adrian Hermann:
My perspective on that has developed over time, through meeting people who work in the field. Including particularly my wife, who is now a business executive. It’s about digital accessibility on the one hand, which means websites broadly speaking and web applications, while on the other it’s about professional work contexts, i.e. working in an office for a large firm. When you have interactions with people working in this area, you start to adopt their perspective. And that very much led me to looking at the issue less from the standpoint of pragmatic implementation, which of course is very important, and more from a scholarly perspective, in line with my principal role at the University. Research and teaching are my primary responsibilities, and after that comes contributing to the University’s institutional culture. And that’s important too, of course. That means making accessibility reality, realizing a barrier-free campus where everyone has access to studying. It extends to all structures, including the web applications we work with every day, and I believe we at the University of Bonn will make numerous advances in accessibility over the next few years. So that is one area where we are concerned with pragmatic implementation. I am interested in accessibility from a research standpoint, meaning my point of inquiry is at a much more fundamental level. Accessibility is inherently an interdisciplinary topic suitable for our transdisciplinary research areas, within the humanities certainly but intersecting with engineering, medicine, computer science, sports science, psychology and all kinds of other fields. The core idea is that we humans are always structuring our access to the world in one highly concrete way or another, so in essence the questions always revolve around what is our relationship to accessibility, to our environment but also to ourselves and our fellow human beings. And what media conditions does that imply? What technical prerequisites? For we humans are creatures who are always employing techniques and technologies in special ways—whether pen or a smartphone. And you can always inquire into how accessibility is actually structured in a given situation. This really fundamental approach of looking at how philosophy and computer science come together in the implementation of assistive technologies is what interests me as a research focus, and where I have been developing projects, especially in the last few months.
Thea Fabian:
Listening to you one already gets a sense of your research vision, that broad cultural change, so to speak, really could yield solutions. Would you agree with that?
Professor Dr. Adrian Hermann:
What we need, in my opinion, are laboratories. I believe that is critical, for making a university more accessible or even barrier-free, particularly a very old institution like the University of Bonn, is really an enormous project when it comes to concretely executing on the objectives. Adopting a very broad understanding of accessibility could in fact be overwhelming to the institution if that has to be lived up to in implementation; I see that as an open question: how much is possibly too much. Because while obviously very important, at the same time it is clear that we don’t have the luxury of starting over entirely from a tabula rasa, as if everything could be redone in a radical restructuring. That’s where I see laboratories coming into play—which society is in need of in general, but are specifically needed at universities in particular. That is what I’m working toward, setting up labs—some physical labs at various locations, others being “labs” for experimentation in a metaphorical sense, like pilot projects. Degree programs, courses, event venues at the University… very specific campus contexts which we will endeavor to render as accessible as is possible. I think it’s important to move on both fronts. My hope is that the University is slowly but surely becoming more accessible, striving toward the goal of being a barrier-free institution. It is a long process, however, that will take time. It can’t really be rushed through. There can’t be the expectation that everything will immediately become 100% barrier-free, but defining the expectations to uphold a high standard is important. We do after all have very high standards regarding diversity, inclusion and accessibility in campus situations like courses and events. And that’s important too in our pilot projects and laboratories, where we try things out and make accessibility a reality. There is a playful element involved, studying questions like “What specific factors make a course or event truly barrier-free? What things are actually needed? Are we even clear on that to begin with? Those are the kind of questions involved.
Thea Fabian:
Indeed, well thank you very much for talking with us, Professor Hermann, it was a pleasure hearing about the many different ideas and approaches.
Professor Dr. Adrian Hermann:
Thank you!
I talked with Professor Adrian Hermann about the significance of inclusion and participation as societal goals. Inclusion concerns people with physical disabilities, but also people representative of neurodiversity, and who may be socially or otherwise challenged in and outside the workplace—with keeping appointments, for example. Inclusion is becoming ever more important at our University. A number of advances toward the goal of being an accessible university will be forthcoming in the near future. Focusing on gaming, Professor Hermann discussed in detail the latest technologies available today to enable people with disabilities to use gaming consoles. These include mouth-operated game controllers and vibration functions enabling blind people to play car racing games by alerting them when they are leaving the track. It is a fascinating topic, where there is a lot of research yet to be done.
Prof. Dr. Adrian Hermann:
Hallo!
Thea Fabian:
Und ich sehe schon, Sie haben einiges mitgebracht und hier auf dem Tisch ausgebreitet. Vielleicht können Sie einfach mal erzählen, was das alles ist.
Prof. Dr. Adrian Hermann:
Ja, ich beschäftige mich in meiner Forschung seit einiger Zeit jetzt aus kulturwissenschaftlicher Sicht auch mit dem Thema Barrierefreiheit. Ich habe jetzt mal zum Thema barrierefreies Gaming, also Videogaming, und ein paar andere Sachen, Alltagstechnologien sozusagen, mitgebracht. Weil man daran eben sehr gut sehen kann, wie dieses Thema eine Relevanz nicht nur medizinisch, sondern einfach ganz normal in der Freizeit hat für alle, die auf das Thema Barrierefreiheit oder eben auf barrierefreie Zugänge angewiesen sind.
Mitgebracht habe ich den Microsoft Adaptive Controller für die Xbox und auch den, relativ neu im Ende letzten Jahres erschienenen, entsprechenden barrierefreien Controller für die Sony Playstation. Und ein paar andere Sachen noch, worüber wir vielleicht nachher dann noch mal beim allgemeinen Thema Barrierefreiheit sprechen könnten.
Thea Fabian:
Ja, vielleicht können wir jetzt erstmal noch auf die Controller eingehen. Die Technik hat sich ja in den vergangenen Jahren so rasant entwickelt und es möglich gemacht, dass auch Menschen mit Behinderung wieder mit Spielkonsolen Spiele spielen können. Können Sie dazu vielleicht ein bisschen Genaueres sagen und mal beschreiben, wie diese Technik funktioniert?
Prof. Dr. Adrian Hermann:
Den Zugang zum Videospielen barrierefreier zu machen, das ist ein Thema, das gibt es schon ganz lange. Das war aber eher von Spezialfirmen oder auch selbst gebaut. Also die Leute haben sich selbst versucht, irgendwie ihre Setups so zu bauen, dass sie eben trotz der Möglichkeiten, die ihnen vielleicht „nur“ noch zur Verfügung stehen - vielleicht konnten sie nur mit einem Arm agieren oder hatten andere Mobilitätseinschränkungen, zum Beispiel - dass sie dann trotzdem Videospiele spielen können. Dafür gab es auch immer schon Lösungen. Jetzt gibt es eben offizielle Unterstützung, zum Beispiel durch Microsoft, also zum Beispiel der Microsoft Adaptive Controller ist eben ein Gerät, das selbst von Microsoft hergestellt und vertrieben wird. Und was es ganz einfach möglich macht, ein eigenes Setup, also eine eigene Einstellung für mich zu finden, auf meine persönlichen Bedürfnisse hin ausgerichtet. Das heißt, ich kann das direkt mit meiner Spielkonsole verbinden, in dem Fall mit der Xbox. Vielleicht kennen die meisten so einen Gamecontroller, ob das jetzt von Nintendo oder eben Playstation ist, wo ich ganz viele Knöpfe und Joysticks dran habe. Wenn ich die aber nicht so bedienen kann, weil ich eben zum Beispiel nicht mit zwei Händen das bedienen kann, dann muss ich es irgendwie anders machen. Und das erlaubt mir eben dieser Microsoft Adaptive Controller, das heißt der bietet mir die Möglichkeit, das Bediensetup auf mich persönlich einzurichten.
Thea Fabian:
Welche Möglichkeiten gibt es da dann?
Prof. Dr. Adrian Hermann:
Es ist eigentlich ganz einfach.
Der Controller bietet für grundsätzlich mal jeden Knopf, den ich sonst auf dem normalen Controller, also dem Controller der mitgeliefert wird, habe die Möglichkeit an einem Klinkeanschluss einen eigenen Schalter, Joystick, Knopf oder irgendetwas anzuschließen, mit dem ich dann die Funktion dieses Knopfes benutzen kann. Das heißt, ich baue sozusagen mein eigenes Setup, habe dann verschiedene Knöpfe für die verschiedenen Funktionen, kann die platzieren, so dass ich sie eben erreichen kann, dass ich sie drücken kann.
Ob das jetzt nun mit der Schulter, mit dem Bein, mit dem Knie, mit dem Kopf wie auch immer ist oder spezifisch noch ausgefeiltere technische Gerätschaften kann ich dann auch anschließen, zum Beispiel einen Joystick, den ich mit dem Mund bedienen kann oder auch, wo ich sozusagen Sachen auslösen kann, indem ich hineinblase oder so was. Also all das ist möglich. Und dieser adaptive Controller vermittelt dann also zwischen diesem Setup von Eingabeelementen von Interfaces zu der Spielekonsole.
Thea Fabian:
Was bedeutet das auch für die Menschen, die jetzt wieder die Möglichkeit haben, solche Spiele zu spielen?
Prof. Dr. Adrian Hermann:
Ich glaube besonders wichtig an diesem Thema ist, dass es eben noch mal klarmacht, dass auch Spaß, Freizeitaktivitäten, eben die komplette Gestaltung des Lebens eben ein Thema für Barrierefreiheit ist. Und zwar ein wichtiges Thema. Also dass Barrierefreiheit eben nicht nur etwas ist, was man sozusagen ermöglichen muss, jetzt von Seiten des Staates in Bezug auf die wichtigsten öffentlichen Funktionen. Also natürlich, ich muss eben auch als Person mit Behinderung in der Lage sein, irgendwie einen neuen Pass zu beantragen und so was. Es ist nicht nur sozusagen etwas, was die Notwendigkeiten des Lebens umfasst, sondern es ist eben auch etwas, was sich auf die Dinge bezieht, was den Leuten einfach Spaß macht. Also es gilt für alle Menschen, die auf barrierefreien Zugang, in dem Fall zu Videospielen, angewiesen sind.
Aber natürlich ist es auch noch mal besonders, dass es vielleicht, wenn ich jetzt eine Person bin…, ich habe mein ganzes Leben lang Videospiele geliebt und jetzt kann ich das eben nicht mehr so fortsetzen, weil ich zum Beispiel einen Unfall hatte oder weil sich eine Lebenssituation verändert hat oder weil ich auch älter geworden bin. So, dann bieten barrierefreie Möglichkeiten eben das an, dass ich weiter dieser Beschäftigung, die mir sehr viel Spaß macht, die mir Freude bringt im Leben, nachgehen kann.
Thea Fabian:
So ähnlich beschreiben das auch die Menschen in dem Video, das ich mir zur Vorbereitung angeschaut habe. Und zwar geht es da um ein Autorennen-Spiel, das man spielen kann, wenn man blind ist. Und das war für mich erst mal was ganz Neues. Aber auch total Faszinierendes, weil ich habe mir das angeguckt und ich habe mich einfach die ganze Zeit gefragt:„ Also Wahnsinn, wie kann das sein, dass dieser Mensch die Spur die ganze Zeit so sauber halten kann, obwohl er das ja gar nicht sehen kann?“ Wie funktioniert das denn?
Prof. Dr. Adrian Hermann:
Also grundsätzlich ist es so, dass wir eben unterscheiden können zwischen dem, worüber wir jetzt gesprochen haben, also wo es letztlich um die Eingabegeräte geht. Und da spielt das natürlich dann sicherlich auch eine Rolle. Aber die andere Seite ist natürlich jetzt die der Software und der Gestaltung der Spiele selbst. Auch die können in unterschiedlicher Weise Barrierefreiheitseinstellungen oder Barrierefreiheitsmöglichkeiten bieten. Und dann, in der Konstellation zwischen Hardware und Software realisiert sich dann eben ein spezifisches Setup, was es Menschen ermöglicht, eben solche Spiele zu spielen.
Also in dem Beispiel von dem Autorennen-Spiel kann man sich jetzt verschiedene Möglichkeiten vorstellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Bildschirm nicht sehen kann oder ein eingeschränktes Sehvermögen habe, dann kann es halt theoretisch sein, dass ich auf der einen Seite eben Rückmeldungen anderer Art kriege, ob ich zum Beispiel gerade die Spur verlasse. Also ich bin zum Beispiel über Druck oder über Vibrationskontroller vielleicht mit dem System verbunden und dann zeigt mir das sozusagen über Vibration an, dass ich mich jetzt gerade nach links oder rechts bewege. So was wäre jetzt Hardware von der Eingabeseite. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel in der Software, das Spur halten sozusagen per Software so einschalten kann, dass ich mich darum gar nicht mehr kümmern muss. So dass ich also den Rest des Spiels sozusagen genießen kann und bestimmte Sachen, die mir schwieriger fallen, dann eben vielleicht von der Software selbst übernommen werden. Also auch diese Möglichkeiten gibt es dann.
Thea Fabian:
Und auch Töne, die dann zum Beispiel dazu beitragen können, oder?"
Prof. Dr. Adrian Hermann:
Also natürlich können jetzt auch alle anderen Möglichkeiten, die man auch aus anderen medialen Zusammenhängen kennt, eben dann Sprachausgabe für Sachen, die ich sozusagen sonst nur sehen kann. Also ist alles vorstellbar, was eben dann da medial realisierbar ist. Deswegen ist das ein Thema, was besonders natürlich jetzt wissenschaftlich auch die Medienwissenschaft sehr interessiert, weil es eben immer im Endeffekt um Eingabe, Interfaces, mediale Verhältnisse geht.
Thea Fabian:
Und ich habe auch in dem Video gesehen, dass es auch Einstellungen gibt, die man bei den Farben durchnehmen kann. Wieso ist das so wichtig?
Prof. Dr. Adrian Hermann:
Genau. Also was es auch schon länger gibt und wo auch glaube ich immer mehr sehr ausgefeilte Features in den neuen Videospielen drin sind oder in den Videospielen, die sich besonders dem Thema Barrierefreiheit auch widmen, sind Einstellungen, die zum Beispiel für Menschen, die eine bestimmte Form von Farbenblindheit haben, dann eben das deutlich vereinfachen, ein solches Spiel zu spielen. Das kann sich vor allem zum Beispiel auf so Bedienelemente, also wenn ich eben bei dem Spiel noch irgendwie Anzeigen habe, da wird zum Beispiel meine Lebensenergie angezeigt und die ist zum Beispiel mit roten Herzen, die sind entweder gefüllt oder nicht. Dann kann das zum Beispiel sehr schwer für mich sein, die zu erkennen und dann kann ich das vielleicht so umstellen, dass das Farbschema eben so angepasst ist, dass ich dann mit meiner spezifischen Voraussetzung dann eben das gut erkennen kann und dann dieses Spiel ohne Probleme spielen kann.
Thea Fabian:
Es ist natürlich super, was jetzt alles schon möglich ist und dass es das gibt. Aber jetzt kommen wir noch mal zu dem finanziellen Aspekt, also unterstützen Krankenkassen heute bei Zugängen zu solchen Techniken?
Prof. Dr. Adrian Hermann:
Also soweit mir bekannt ist, ist das eher nicht der Fall. Das ist auch ein Problem. Also grundsätzlich ist es so, das war eben auch einer der wichtigen Schritte jetzt mit diesen neuen Technologien, dass die Hersteller der Spielekonsolen das jetzt selbst unterstützen und dass das eben dann auch auf dem Markt verfügbar ist. Dadurch ist es einfacher zu bekommen und nicht mehr ganz so teuer. Dennoch sind die Setups natürlich immer noch teuer. Wenn man jetzt dann sozusagen neben dem Controller selbst noch die verschiedenen individuellen Knöpfe, Schalter, Joysticks und so weiter braucht. Die können zum Teil sehr, sehr teuer sein, je nachdem, was man da braucht. Und all das, genauso wie Spielkonsolen selbst und soweit mir bekannt ist, eben im Endeffekt auch Computer selbst oder Smartphones, werden in den seltensten Fällen von Krankenkassen übernommen, weil die sozusagen zur Alltagstechnologie zählen und eben nicht als Hilfsmittel dann in Deutschland zumindest verordnet werden können. Und jetzt, wo unser Leben halt immer digitaler wird, immer stärker diese Technologien - selbst wenn es jetzt nicht um eine Spielkonsole geht, sondern eben Computer, Smartphone, und so weiter - ist es natürlich tatsächlich schwierig, wenn man so etwas, was einen grundsätzlichen Zugang ermöglicht, zu ganz vielen Sachen in der Gesellschaft und im Leben halt eben nicht durch die Krankenkassen bezuschussen lassen kann.
Thea Fabian:
Was würden Sie sagen, wie wird da so die Zukunft aussehen oder die zukünftige Entwicklung sein?
Prof. Dr. Adrian Hermann:
Das ist schwer zu sagen, aber es führt natürlich auch oder verweist auch noch mal auf das größere Thema Barrierefreiheit, also wie die rechtlichen Entwicklungen jetzt gerade bei dieser Hilfsmittelverordnung sich weiterentwickeln, das kann ich jetzt, nicht so gut beurteilen. Aber was ganz klar ist, ist, dass das Thema Barrierefreiheit insgesamt ganz klar an Bedeutung zunehmen wird. Und das liegt schon an getroffenen Rechtsentscheidungen oder an neuen rechtlichen Verhältnissen. Also was sozusagen da in der Zukunft noch kommt, wissen wir nicht so genau. Aber was es gibt, sind so Sachen wie europäische Entscheidungen dieser Art, also den European Disability Act zum Beispiel. So wird das dann manchmal genannt, der wiederum dann in Deutschland umgesetzt wird, also sozusagen EU-Vorgaben, die dann in deutsche Gesetze umgesetzt werden. Und da ist das Ergebnis, dass wir vor allem ab 2025 eine sehr viel klarere Situation haben werden, wo eben auch Privatunternehmen immer weiter - es gibt da noch bis 2030 so eine Art Ausnahmeregelung, vielleicht in bestimmten Fällen - aber an sich werden immer weiter eben neben öffentlichen Institutionen, für die das eh schon gilt, also Universitäten, Ämter und so weiter, auch Privatunternehmen letztlich immer stärker auf Barrierefreiheit achten müssen. Und in dieser Situation ist dann natürlich auch so was noch mal zu erwarten, dass sich die Situation im besten Fall deutlich noch mal verbessert.
Thea Fabian:
Wir haben an diesem ein Thema jetzt gesehen, welche Chancen Menschen entgehen können, wenn wir die Inklusion dieser Menschen vernachlässigen. Barrierefreiheit? Wie wichtig ist dieses Thema gesamtgesellschaftlich? Also fangen wir da jetzt zum Beispiel mal bei baulichen Projekten an, wie Gebäuden oder auch Arbeitsplätzen.
Prof. Dr. Adrian Hermann:
Ja, ich glaube, dass das Thema Barrierefreiheit eben auch da uns in Zukunft deutlich stärker noch beschäftigen wird. Also manche, gerade bauliche Veränderungen, die sind uns ja vielleicht auch allen, stehen uns irgendwie vor Augen. Wir sehen das irgendwie wenn Treppen überwunden werden müssen, dann begegnet uns das vielleicht im Alltag. Oder eine Sache, die wir jetzt auch gerade aus der Pandemie vielleicht alle sehr dankbar zur Kenntnis genommen haben, sind eben Türöffner, die man mit dem Fuß oder auch mit dem Knie irgendwie bedienen kann und die ursprüngliche eigentlich mal dafür da sind Menschen mit Mobilitätseinschränkungen den Zugang zu erleichtern. Also diese Art von baulichen Themen in der Barrierefreiheit, die sind wichtig und werden sicherlich auch in Zukunft sich noch weiter, zumindest jetzt zum Beispiel in Deutschland, in der Gesellschaft etablieren. Davon gehe ich aus. Das ist auch zu hoffen. Darüber hinaus ist es aber glaube ich so, dass die Perspektive der Barrierefreiheit an sich jetzt aus meiner Sicht als Wissenschaftler sozusagen das Interessante ist, also das, was eigentlich in den Blick kommt, wenn man beginnt, die Welt sozusagen aus der Perspektive der Barrierefreiheit zu betrachten. Das ist sozusagen das interessante Thema, weil das dann eben über die Einzelthemen hinaus auch wirklich noch mal auf Dinge verweist, die man sonst vielleicht gar nicht so wahrnimmt.
Thea Fabian:
Ja, und diese Änderungen betreffen ja eigentlich auch nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern machen das Leben auch nicht behinderter Menschen einfacher, oder?
Prof. Dr. Adrian Hermann:
Genau. Grundsätzlich ist es sowieso eigentlich so, dass diese Perspektive der Barrierefreiheit oder auf Englisch Accessibility, dass das eigentlich für alle Menschen relevant ist oder dass zumindest Lösungen, die sozusagen Barrieren abbauen, die was auch immer es gerade ist, ob es die Universität ist oder eben in dem Fall, das Gaming, barriereärmer gestalten, dass das eigentlich für alle Menschen die Situation potenziell verbessert. Und das liegt eben daran, man kann dann in unterschiedlicher Weise das sich angucken oder mit unterschiedlichen Modellen da arbeiten. Aber grundsätzlich ist im Endeffekt das Wichtige, dass wir sehen, dass alle Menschen über ihren Lebensverlauf vermutlich in irgendeiner Situation sehr gut solche barrierearmen Situationen nutzen können oder von denen profitieren können. Und dass kann jetzt situationsbezogen sein, also der Vater oder die Mutter mit Kinderwagen in der Stadt können sozusagen auch abgesenkte Bordsteine nutzen, um da eben drüber zu fahren. Genauso wie eine Person, die mit dem Rollstuhl unterwegs ist. Genauso kann man sozusagen Spracheingabe nutzen. Wenn jetzt eben eine Person ein Smartphone verwendet, die zum Beispiel blind ist, dann kann ich mit Spracheingabe arbeiten. Aber ich kann die gleiche Spracheingabe auch nutzen, wenn ich zum Beispiel entsprechend in meinem Auto verbaut habe, irgendwie ein entsprechendes System und dann vielleicht sozusagen irgendwie eine Textnachricht diktieren kann, also diese Techniken betreffen alle. Und natürlich besonders auch im Alter, also welche Vorteile wir sozusagen alle haben, von einer barrierefrei eingerichteten Gesellschaft, wenn wir älter werden und dann vielleicht, ob es jetzt eben mit der Sehkraft oder Kraft oder was auch immer sich da verändert, auch da können wir auf solche Sachen dann zurückgreifen.
Thea Fabian:
Barrierefreiheit betrifft uns also alle in gewisser Weise. Aber es ist ja auch nicht nur ein Thema von körperlicher Inklusion, oder? Also wie sieht es zum Beispiel mit Menschen aus, die ADHS haben oder mit autistischen Menschen?
Prof. Dr. Adrian Hermann:
Also auch hier gilt, dass die Perspektive der Barrierefreiheit sich erst mal an alle Menschen richtet und dass das eben besonders auch Menschen betrifft, wo wir dann zum Beispiel von Neurodiversität sprechen können, also Menschen, die einfach für ein produktives und glückliches Leben sozusagen, je nachdem, wie sie es dann eben leben wollen, ob das jetzt im Privatbereich oder auch am Arbeitsplatz ist, deutlich davon profitieren können, dass ihr Umfeld barrierefreier gestaltet ist, als das jetzt vielleicht der Fall ist. Und das ist zum Beispiel dann eben auch im Arbeitsplatzbereich, gibt es da einfach, glaube ich, noch sehr, sehr viele Möglichkeiten und Dinge, die uns eben gar nicht so bewusst sind, wenn wir eben selbst diese Situation nicht kennen. Also ich glaube, da gibt es einen großen Bedarf und auch da ist wieder das Spannende, dass eigentlich diese Perspektive der Barrierefreiheit uns hilft, uns eben auch selbst zu reflektieren. Also was sind eigentlich die Dinge, von denen wir ganz selbstverständlich ausgehen, dass sie unproblematisch sind oder dass man sie halt einfach so machen kann? Bauliche Barrierefreiheit ist immer einfach. Wenn wir hier zum Beispiel einen Raum haben, den man nur über ein paar Stufen erreichen kann. Es gibt keine Möglichkeit, die Stufen zu überbrücken, dann ist es halt nicht zugänglich für eine Person, die im Rollstuhl sitzt. Normalerweise. So, das ist dann für alle irgendwie klar sichtbar. Aber eben zum Beispiel was sich jetzt für Barrierefreiheitsthemen verbinden mit der Frage, ob man eben eine Veranstaltung, die angekündigt ist oder ein Meeting im Arbeitskontext, es geht von genau dann bis genau dann und es wird nicht jedes Mal unklar zwischen zwei und 25 Minuten überzogen. So, das wäre dann zum Beispiel so ein Thema. Das ist vielleicht nicht gleich erkennbar als Barrierefreiheitsthema, aber je nachdem, ob es jetzt um Menschen mit ADHS oder autistische Menschen geht, das könnten alles Themen sein, die da sehr zentral relevant sind, damit eben diese Menschen sich selbst auch in ihren Arbeitskontexten zum Beispiel wohlfühlen. Und so kommt man eben auf eine ganz große Zahl an Themen, die man unter der Perspektive der Barrierefreiheit adressieren könnte.
Thea Fabian:
Sie haben es ganz am Anfang schon mal angesprochen. Wenn wir jetzt auch noch mal auf die Metaebene gehen und das Ganze theoretisch, kulturell und philosophisch betrachten, da kann Barrierefreiheit noch viel mehr sein als die Beispiele, die uns üblicherweise hierzu einfallen. Sie haben es ja auch gerade schon gesagt, dass es da noch viel mehr gibt, als man eigentlich denken würde. Gibt es da noch mehr gesellschaftliche Bereiche oder Beispiele, die Ihnen da einfallen?
Prof. Dr. Adrian Hermann:
Also meine Perspektive, die sich eben durch die Begegnung auch mit Menschen, die eben in diesem Bereich arbeiten, in meinem Fall ist es speziell auch meine Frau, die da sozusagen in leitender Funktion jetzt in der Wirtschaft tätig ist. Da geht es besonders um digitale Barrierefreiheit einerseits, also Webseiten im weitesten Sinne und Webanwendungen und auf der anderen Seite dann eben professionelle Arbeitskontexte, also Büroarbeit in großen Unternehmen. Wenn man mit diesen Menschen zu tun hat, die in diesem Zusammenhang arbeiten, dann beginnt man eben irgendwie die Welt so ein bisschen aus dieser Perspektive zu betrachten. Und mich hat das sehr stark dazu geführt, das eben auch noch mal weniger als ein Thema zu betrachten, was jetzt vor allem auf eine pragmatische Umsetzung zielt, die es auch sehr wichtig, aber dafür bin ich natürlich an der Universität nicht primär zuständig. Also meine Aufgabe liegt ja erst mal in der Forschung und Lehre und dann sozusagen vielleicht noch im Beitrag zu der institutionellen Kultur der Universität. Aber auch das ist natürlich wichtig, das zu unterstützen. Das heißt Barrierefreiheit einfach umgesetzt, dass der Campus barrierefrei ist, dass der Zugang zum Studium, dass sozusagen alle unsere Strukturen, sei es auch in dem Fall zum Beispiel unsere Webanwendungen, auch da können wir ja, glaube ich, an der Universität Bonn hoffen, dass wir eben in den nächsten Jahren noch einige Fortschritte machen können im Bereich Barrierefreiheit sozusagen auch unserer Webanwendungen, mit der wir sozusagen tagtäglich arbeiten. So, das ist die eine pragmatische Richtung. Aber eben als Forscher interessiert mich sozusagen dieses Thema der Barrierefreiheit, der Accessibility oder eben, wie man jetzt auch sagen könnte, der Zugänglichkeit noch mal in einer viel grundlegenderen Weise. Also Zugänglichkeit als ein Begriff, der sich dafür eignet, inter- und transdisziplinär eben über die Disziplingrenzen hinweg, sowohl innerhalb der Geisteswissenschaft, aber eben auch im Kontakt mit Ingenieurswissenschaften, mit Medizin, mit Informatik, mit der Sportwissenschaft, mit allen möglichen Disziplinen zu arbeiten, mit Psychologie und so weiter. Und über diese Idee, dass wir Menschen unseren Weltzugang immer in irgendeiner Weise, in ganz konkreter Form realisieren, also dass es immer darum geht: Wie sind wir? Wie ist eigentlich unser Verhältnis der Zugänglichkeit zu unserer Umwelt, zu uns selbst, zu unseren Mitmenschen gestaltet? Welchen medialen Verhältnisse impliziert das? Und auch welche technischen? Weil wir Menschen sind ja Wesen, die in irgendeiner Weise immer Techniken, Technologien benutzen, so sei es jetzt ein Stift oder eben ein Smartphone. Und man kann dann immer fragen, wie eigentlich Zugänglichkeit in dieser konkreten Situation gestaltet ist und diese sehr grundlegende Perspektive von der Philosophie sozusagen bis in die Informatik und in die Umsetzung assistiver Technologien, das ist das, was mich dann eben gerade forschungstechnisch interessiert und wo ich auch Projekte entwickle und entwickelt habe in den letzten Monaten.
Thea Fabian:
Wenn man Ihnen so zuhört, kann man schon ahnen, dass eine wissenschaftliche Vision durchaus auch ein ja quasi Kulturwandel im Gesamten als Lösung im Raum steht. Stimmt das so?
Prof. Dr. Adrian Hermann:
Also ich glaube, was wir brauchen, sind Labore. So, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Denn es ist richtig, die Universität als eine sehr alte Institution, auch eine spezifische Universität wie die Universität Bonn, durchgängig barriereärmer oder sogar barrierefrei, was auch immer das dann konkret heißen mag, zu gestalten, ist wirklich eine riesige Aufgabe. Das ist etwas, das ist, glaube ich, noch offen, inwieweit das nicht die Institution vielleicht sogar überfordern würde, wenn man eben diesen Begriff der Barrierefreiheit sehr breit versteht. Weil es aber trotzdem ganz klar ist, dass es wichtig ist, das zu tun, weil aber gleichzeitig klar ist, wir können hier nicht von Anfang an, wir können nicht damit anfangen, einfach alles radikal komplett umzubauen. Deswegen brauchen wir, glaube ich, Labore, also auch gesellschaftlich generell. Das betrifft jetzt nicht nur die Universität, aber spezifisch eben auch in der Universität. Und dafür will ich mich eben dann auch einsetzen, dass wir eben an verschiedensten Stellen solche Labore und das können konkrete Orte sein, aber es können eben auch in dem Sinne sozusagen in übertragenerweise Labore, also Pilotprojekte sein. Dieser Studiengang, diese Veranstaltung, dieser Ort, an dem Veranstaltungen stattfinden können an der Universität. Also ganz spezifische Zusammenhänge dann wirklich so barrierefrei wie möglich zu gestalten. Also es gibt, glaube ich, sozusagen beide Richtungen sind wichtig. Die Universität befindet sich hoffentlich auf einem langsamen Weg in sozusagen zu zunehmender Barrierefreiheit oder barrierearme Universität. Das ist aber ein langer Prozess, der wird dauern. Das kann man sozusagen auch vielleicht nicht unbedingt übers Knie brechen. Und dann ist es aber vielleicht wichtig und da ist der Anspruch, da kann der Anspruch sozusagen auch nicht unbedingt sein, dass es sofort alles komplett barrierefrei ist. Umgekehrt halte ich es eben genau deswegen für relevant, dass wir Orte haben, Situationen, Veranstaltungen, Pilotprojekte, Labore, an denen dann wirklich ein sehr hoher Anspruch an Diversität, Inklusion, Barrierefreiheit umgesetzt, gelebt und ausprobiert wird. Das hat dann auch was Spielerisches. Wir experimentieren mal hier: Wie ist das, eine Veranstaltung wirklich grundlegend barrierefrei zu machen? Was brauchen wir überhaupt? Wissen wir das überhaupt alles schon? Das ist das sind dann die Fragen, die da ins Spiel kämen.
Thea Fabian:
Ja, vielen Dank für das Gespräch und die ganzen Ideen und Ansatzweisen heute, Herr Hermann.
Prof. Dr. Adrian Hermann:
Vielen Dank!
Thea Fabian:
Mit Dr. Adrian Hermann habe ich darüber gesprochen, was Inklusion und Teilhabe als gesellschaftliche Aufgabe bedeutet. Dabei ist Inklusion nicht nur ein Thema für körperliche Behinderung, sondern auch für geistige und soziale Praktiken in der Lebens- und Arbeitswelt, wie zum Beispiel das Einhalten von Terminen. Auch an unserer Uni spielt Inklusion eine immer wichtigere Rolle. Und das soll in kommender Zeit einige Neuerungen bezüglich einer barrierearmen Universität geben. Am Beispiel Gaming hat mir Herr Hermann konkret erklärt, welche Möglichkeiten es durch moderne Technologien heute gibt, damit auch Menschen mit Behinderung an Spielekonsolen spielen können. So können Controller zum Beispiel mit dem Mund gesteuert werden und Vibrationen zeigen blinden Menschen bei Autorennen an, ob sie die Spur richtig halten. Auf jeden Fall ein spannendes Thema, bei dem es noch viel zu erforschen gibt.